Zwi Rappoport,
Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe K.d.o.R.
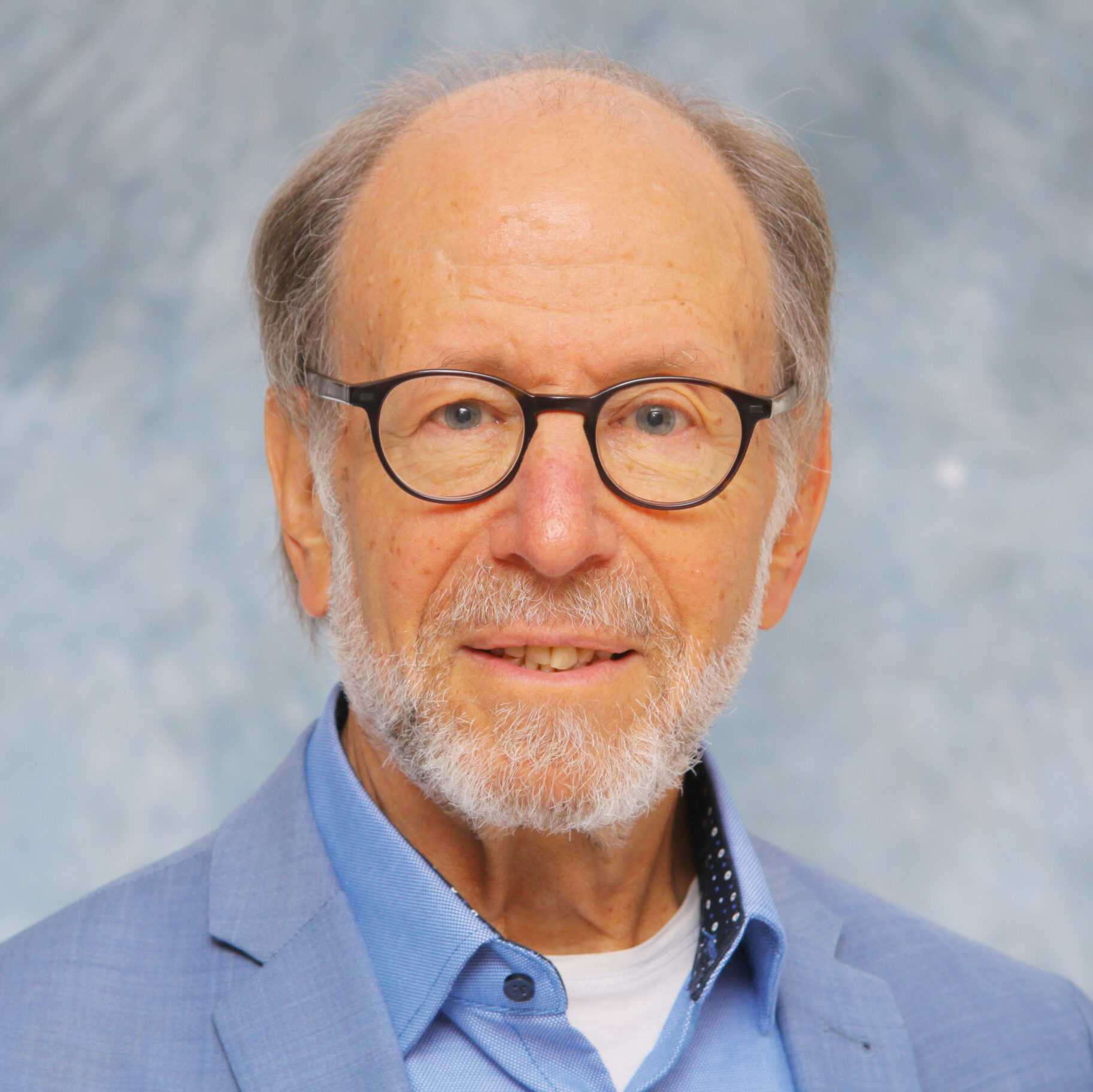
Rede von Zwi Rappoport anlässlich der Gedenkstunde zum Holocaustgedenktag am 27.01.2025 im Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) Dortmund
Sehr geehrter Herr Rabbiner Nosikov,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Westphal,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rensmann,
verehrte Gäste,
Als ich von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit gebeten wurde, zum heutigen Gedenktag ein Grußwort zu sprechen, war mir von vornherein klar, dass es eher eine Bestandsaufnahme des christlich-jüdischen Verhältnisses als ein Grußwort sein würde.
Denn seit dem Terrorangriff der Hamas und den darauffolgenden Kriegen in Gaza und im Libanon ist das jüdisch-christliche Verhältnis stark beeinträchtigt, manche würden sagen schwer beschädigt.
Die jüngsten Scherben in diesem Verhältnis sind – ausgerechnet zur Weihnachtszeit – in Rom entstanden.
Mitte Dezember geht ein Bild um die Welt: Papst Franziskus im Rollstuhl vor einer Krippe. Das Jesuskind, jüdischer Sohn einer jüdischen Mutter, liegt auf einer schwarz-weißen Kufija, einem Palästinensertuch.
Das Bild löste allenthalben heftige Kritik aus.
Der Oberrabbiner von Genua, Vizepräsident der italienischen Rabbinervereinigung, sprach von einer Palästinensierung des jüdischen Jesus, der seiner „historischen Identität“ beraubt werde. Papst Franziskus schädige durch solche expliziten und symbolischen Handlungen die Beziehungen zum Judentum. Auch von christlicher Seite wurde bemängelt, dass Jesus damit für politische Zwecke instrumentalisiert und „israeltheologisch“ entwurzelt werde – so der katholische Theologe und Hochschulprofessor Jan-Heiner Tück und die evangelische Theologieprofessorin Petra Heldt.
Zwar verschwand daraufhin das Palästinensertuch samt dem Jesuskind bei der nächsten Papstaudienz.
Aber erneut wurde jüdisch-christliches Porzellan zerschlagen.
Das geht nun schon seit 15 Monaten so. Nicht nur von jüdischer Seite wird dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eine einseitige Sichtweise auf den Nahostkonflikt vorgeworfen.
So kritisieren die beiden katholischen Hochschullehrer René Dausner und Christian Frevel einen Brief des Papstes an die Katholiken im Nahen Osten.
In dem Papstschreiben sei nur das Leid der palästinensischen Bevölkerung erwähnt. Israel tauche in dem Brief nicht auf.
„Der Brief nimmt nur eine Seite des Leidens in den Blick und macht implizit die Gegenseite zu den Verursachern“ beklagen Dausner und Frevel.
„Es gibt also einen blinden Fleck im Denken des Argentiniers“, stellen die beiden Theologen fest. Zudem nutze Papst Franziskus antijüdische Klischees, und zitiere die Zitat: „antijudaistischste Stelle“ im neuen Testament. Dies widerspreche der gesamtkirchlichen Haltung gegenüber dem Judentum nach der Shoah.
Auch für seinen jüngsten Vorschlag, man solle die Genozid-Vorwürfe gegen Israel sorgfältig überprüfen, erntete der Papst heftige Kritik.
Für den Salzburger Theologen Gregor Maria Hoff hat Franziskus damit die Grenze der Neutralität überschritten und sich in einem internationalen Konflikt zur Partei gemacht.
„Seine hochproblematischen Aussagen stellen ein Risiko für Israel als Staat und für die Juden weltweit dar“, so der Theologe.
Die europäische Rabbinerkonferenz zeigte sich ebenfalls „zutiefst beunruhigt“.
Israel führe einen Verteidigungskrieg gegen einen barbarischen Feind, der von keinem westlichen Rechtskodex und keiner Kriegskonvention gezügelt werde, betonten die Rabbiner.
Das Land kämpfe zudem für die Rückkehr der verschleppten Geiseln. Der Begriff „Genozid“ werde heute als Propagandamittel benutzt, um die Verantwortung von den Tätern auf die Opfer zu verlagern.
Solche Irritationen im Verhältnis zwischen Juden und Katholiken treten mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf.
Ich erinnere mich schmerzlich an den deutschen Papst, Benedikt den XVI., der 2008 die lateinische Karfreitagsmesse wieder zuließ, in der für die Erleuchtung der Juden gebetet wird, „damit sie Jesus Christus erkennen, den Erlöser aller Menschen“.
Viele Juden fassten die Karfreitagsfürbitte als Aufforderung zur längst überwunden geglaubten Judenmission auf und sahen ihren Glauben in antijüdischer Tradition als „mangelhaft“ definiert.
Zu allem Überfluss hob Benedikt die Exkommunikation von vier Bischöfen der erzkonservativen Pius Brüderschaft auf, unter ihnen der Brite Richard Williamson, ausgewiesener Antisemit und Holocaustleugner!
Seinerzeit hat uns Juden der Sturm der Entrüstung aus allen gesellschaftlichen Bereichen, und insbesondere die eindeutige Stellungnahme fast aller deutschen Bischöfe Hoffnung gemacht, dass das neue Verhältnis zwischen Juden und Christen nicht mehr umkehrbar sein würde.
In der aktuellen Situation aber sind wieder starke Zweifel angebracht;
insbesondere deshalb, weil auch in der evangelischen Kirche äußerst beunruhigende Tendenzen sichtbar werden.
Ein Beispiel aus jüngster Zeit:
Auf einem so genannten anti-kolonialen Weihnachtsmarkt, den eine evangelische Kirchengemeinde und eine „Initiative4Palestine“ in Darmstadt veranstaltete, wurden Symbole der Hamas angeboten, wie etwa ein Schlüsselanhänger mit dem berüchtigten roten Dreieck, mit dem die Hamas ihre Feinde markiert und Angriffsziele kennzeichnet; oder Stofftaschen mit einer Landkarte, auf denen der Staat Israel verschwunden und durch „Palestine“ ersetzt ist, sowie Flyer mit der berüchtigten Parole „From the River to the See“, mit der zur Vernichtung Israels aufgerufen wird.
Die evangelische Landeskirche Hessen-Nassau hat daraufhin die Notbremse gezogen, sich den Strafanzeigen der Stadt und der jüdischen Gemeinde Darmstadt angeschlossen und dem Pfarrer vorläufig das Ausüben seines Amtes untersagt.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung.
Wie kann es sein, so fragen sich viele, dass ein Weihnachtsmarkt, ein Ort der Besinnlichkeit und der Vorfreude, zu einem Hamas-Propaganda-Fest, zu einem Ort des Hasses missbraucht wird.
Als Erklärung hilft womöglich ein Blick auf die Haltung der christlichen Weltbünde zu Israel.
Am 8. Oktober 2023, nur einen Tag nach dem Pogrom der Hamas, als noch immer dutzende Terroristen in Israel aktiv waren und noch während die überfallenen Kibbuzim von der israelischen Armee frei gekämpft werden mussten, veröffentlichte der Lutherische Weltbund auf seiner Homepage folgendes Statement:
Der Lutherische Weltbund reagiere mit – so wörtlich – „großer Betroffenheit auf die Angriffe der Hamas auf Städte in Israel und auf die Zivilbevölkerung des Landes sowie auf die darauffolgende Vergeltung der israelischen Armee“ – Zitat Ende.
Das beispiellose Massaker der Hamas, bei dem in Israel mehr als 1200 Menschen brutal ermordet und 251 Menschen in die Tunnel der Hamas verschleppt wurden, rückt der Lutherische Weltbund auf eine Ebene mit der Verteidigung der israelischen Streitkräfte, die hier gleich „Vergeltung“ genannt wird.
Es ist nicht nur der Lutherische Weltbund, der sich so äußert:
Der ökumenische Rat der Kirchen, appellierte einen Tag später, die Hamas möge ihre Angriffe einstellen und bittet beide Parteien um eine „Deeskalation der Situation“. Ähnlich äußerte sich die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, die lediglich von „jüngsten Feindseligkeiten zwischen Israel und Palästina“ spricht.
Über die Grausamkeiten der Hamas – dazu findet sich kein Wort in den Erklärungen der drei christlichen Weltbünde, kritisiert Christian Staffer, der Antisemitismusbeauftragte der Evangelischen Kirche Deutschland.
Es sei aber gerade diese „abgründige Gewalt“ der Hamas, die Christinnen und Christen wirklich mitten ins Herz fahre.
Maria Kors, Projektleiterin bei der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Frankfurt am Main, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Weltbünde ausgesprochen vielfältig seien mit Stimmen aus dem globalen Süden und aus dem arabischen Raum. Da gerate eine Post-Shoah-Theologie, die sich um eine Aufarbeitung christlicher Judenfeindschaft bemüht habe, aus dem Blick. Sie werde polemisch abgewehrt als historisch bedingter, deutscher Sonderfall, der für den Rest der Christenheit nicht nur nicht relevant sei, sondern den Blick auf echte Theologie verstelle.
Ursache dieser Entwicklung sei die missbräuchliche Übernahme postkolonialer Kritik in die theologische Debatte, um dadurch eine selbstkritische Bearbeitung von christlicher Judenfeindschaft abzuwehren. Dies sei quasi eine theologische Version von Schuldabwehr.
Günther Thomas, Professor für Systematische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum, geht sogar so weit, die verschiedenen Erklärungen der christlichen Weltbünde als – Zitat:
„Ökumene des Antisemitismus“ zu bezeichnen. Die merkwürdige Distanz, die merkwürdige Vorwurfshaltung gegenüber Israel, die selbst die ersten Reaktionen unmittelbar nach dem Hamas-Massaker durchzogen haben, sei Teil einer großen Verschiebung innerhalb der Theologie.
Die heilsgeschichtliche Dimension des klassischen Antijudaismus habe ein neues Objekt gefunden.
Er stellt fest: „Gönnte man den Juden früher nicht das Heil, so gönnt man ihnen heute nicht das Land“.
Die Empathielosigkeit, wie sie sich in den Stellungnahmen der christlichen Weltbünde ausdrücke, rühre aus einer tiefen Skepsis gegen den Staat Israel, erst recht in einer Situation, in der sich der jüdische Staat seiner Feinde mit Gewalt erwehren müsse. Das besondere Verhältnis von Kirche und Judentum aufgrund einer gemeinsamen Wurzel löse sich auf.
Eine niederschmetternde Analyse, zumal es der Ökumenische Rat der Kirchen war, der Antisemitismus 1948 als Sünde gegen Gott und die Menschheit klassifizierte.
Christlich fundierter Antijudaismus sei keineswegs ein deutsches oder europäisches Problem, sagt Christian Staffer, der Antisemitismusbeauftragte der EKD. Sich dem zu stellen sei vielmehr eine Aufgabe für die ganze Christenheit.
Bei allen Rückschlägen, wie sie sich aus seiner Sicht in den vergangenen 15 Monaten etwa in der Debatte zur Haltung der Weltbünde zeigten, sieht er dennoch Fortschritte, die in den Deutschen Kirchen erzielt wurden. Er betont, dass die EKD, aber auch die Landeskirchen, eine stabile Position zu Israel hätten, die – Zitat: “Nicht denunzierend ist, die nicht abwertend ist, die nicht Völkermord und Apartheid sagt.“
Daran lasse sich anknüpfen, im neuen Jahr und in den weiteren Jahren.
Christlicher Antijudaismus, das Problem, sei nun mal 2000 Jahre alt.
Ich kann dazu nur bemerken: lasst uns hoffen und beten, dass dieses Problem nicht weitere 2000 Jahre bestehen wird.
Verehrte Anwesende,
80 Jahre nach Auschwitz müssen wir leider feststellen:
die Menschheit scheint kaum aus der Geschichte gelernt zu haben.
Trotz aller gesellschaftlichen und politischen Versprechen, dass es kein Platz für Antisemitismus in Deutschland gibt, ist jüdisches Leben so gefährdet und bedroht wie noch nie seit der Shoah.
Wenn Staat und Gesellschaft nicht endlich eine überzeugende Antwort auf den grassierenden Antisemitismus finden, könnte es zu spät sein.
Dann wäre Hitlers Wunsch nachträglich in Erfüllung gegangen:
Ein judenfreies Deutschland.
Möge Gott uns davor bewahren.
